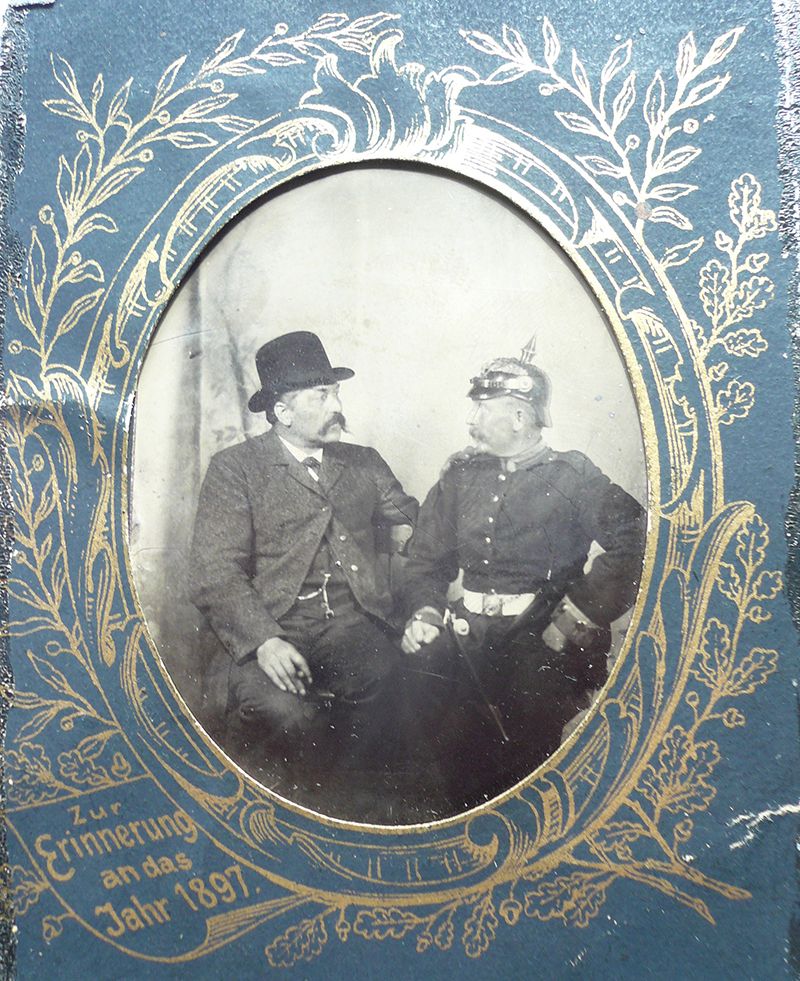
1902 Bauboom im heutigen Vogteiweg
Der „Bebauungsplan Amtsvogteigarten“
Nach der deutschen Reichsgründung von 1871 und den hohen Reparationsgeldern, die Frankreich nach dem verlorenen Krieg (1870/71) an Deutschland zahlen musste, kam es im neu gegründeten Deutschen Kaiserreich zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung. Dieser ökonomische Aufschwung hat auch vor Amelinghausen nicht Halt gemacht. Hinzu kommt, dass das mittelalterliche Lehnssystem seit der Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft war und die Bauern keine Abgaben mehr an den Lehnsherrn zu leisten hatten. Sie waren nun Eigentümer ihrer Höfe und konnten ihre Gewinne maximieren. Auch die höheren Preise für Agrarprodukte am Ende des 19. Jahrhunderts hatten ihnen ein höheres finanzielles Einkommen beschert, so dass immer mehr Aufträge an Handwerker vergeben wurden. Man konnte nicht mehr alles allein machen.
Um 1900 hatte Amelinghausen 500 Einwohner, von denen weniger als die Hälfte noch von der Landwirtschaft lebten. 1868 wurde im Norddeutschen Bund, zu dem auch das ehemalige Königreich Hannover gehörte, die Gewerbefreiheit eingeführt. Nun konnten die Handwerker, die bis dahin als Einlieger bei Bauern wohnten und für Kost und Logie arbeiteten, zusätzlich durch nebenbei ausgeführte handwerkliche Arbeiten Geld verdienen. Durch die zunehmende Bedeutung der Geldwirtschaft wurden handwerkliche Dienstleistungen nicht mehr ausschließlich mit Naturalien beglichen. Nun lag es nahe, ein Haus zu bauen und sich selbständig zu machen.
1852 wurde die Vogtei Amelinghausen aufgelöst und an die Vogtei Salzhausen angeschlossen. Der 1 ha 86 Ar 8 qm große domänen-fiskalische Amtsvogteigarten wurde – da es jetzt keinen Amtsvogt mehr gab - zu einem geringen Pachtpreis an vier Pächter verpachtet, von denen der Gastwirt Studtmann (heutiges Rathaus) und der Vollhöfner Studtmann (Glockenhof) den größten Anteil hatten.
Schon 1893 hatte der Domänen-Fiskus vorschlagen, den Garten an Bauwillige zu verkaufen. Aufgrund der damaligen schlechten Wirtschaftslage fanden sich aber keine Käufer.
1902 sollte es anders sein. Die Nachfrage war auf einmal groß. Der Domänen-Fiskus hat die Pachtverträge, die noch bis 1908 liefen, gekündigt –was vertraglich möglich war – und versuchte, den Garten als Ganzes zum Verkauf anzubieten. Auf diese Weise wollte man sich die Mühe mit den Einzelverkäufen ersparen.
Es lagen auch schon Kaufangebote vor. Der Uhrmacher Bullermann wollte alle neun Landlose für 6200 Mark kaufen, der Schneidermeister Bartels nur drei. In einem Brief vom 27. Januar 1902 schreibt Bullermann an den Regierungspräsidenten. „Hierdurch erkläre ich, daß ich mich an mein Angebot vom 16ten September 1902 bis zum 1ten Oktober 1903 gebunden halte. Georg Bullermann Uhrmacher“
Der Gemeindevorsteher Gade beglaubigt diesen Brief mit dem Zusatz: „Die eigenhändige Unterschrift des Georg Bullermann und die Zahlungsfähigkeit desselben von 6200 M. wird hiermit beglaubigt“.
Es entwickelte sich nun ein reger Schriftverkehr bezüglich der Verkaufsmodalitäten und Erschließung der Baugrundstücke. Schließlich hat sich der Domänen-Fiskus für den Einzelverkauf der Grundstücke entschieden. Der Gastwirt und der Bauer Studtmann konnten sich mit ihren Wünschen, den Amtsvogteigarten nicht zu verkaufen, um weiterhin als Pächter aufzutreten, nicht durchsetzen.
Da das Gelände von Norden nach Süden und von Osten nach Westen sehr abschüssig ist, musste eine vernünftige Wegführung gefunden werden. Ursprünglich sollten die Käufer den Weg anteilig nicht nur erwerben, sondern auch herrichten und unterhalten. Gemeindevorsteher Gade war gegen diesen Vorschlag und konnte sich mit seinem Plan durchsetzen: Der Fiskus überlässt der Gemeinde kostenlos eine 2000 m2 große Fläche für den Weg und richtet ihn auch her. Die Gemeinde würde für die späteren Unterhaltungskosten aufkommen. Nun konnte der Bauboom losgehen. Es entstand eine Handwerkerstraße mit folgenden Berufen: Schneider (Bartels), Drechsler(Kröger) und Sattler (Kröger), Fuhrunternehmer (Burmeister) Maurer (Drewes, später Wiekhorst), Dachdecker (Stelter), Uhrmacher (Bullermann) und Tischler(Rüter, später Gade, heute Stelter am Jungfernstieg). Zwei Landlose wurden nicht zur Bebauung verkauft. Kaufmann Lüchow konnte seinen Garten und Bauer Studtmann seinen Hofplatz vergrößern.
Alles in allem hat das Domänenrentamt für die neun Grundstücke 8200 Mark bekommen, was bei dem damaligen Zinssatz von 3,5 % weitaus mehr war als das geringe Pachtgeld.
Der Vogteiweg war sozusagen der erste „Bebauungsplan“ in unserem Dorf und ein Zeichen für ökonomisches Wachstum und Bevölkerungszunahme.
(Quelle: HSTAN Hann 180 Lüneburg Acc 3-119 Nr 335, Seiten 40-88)
